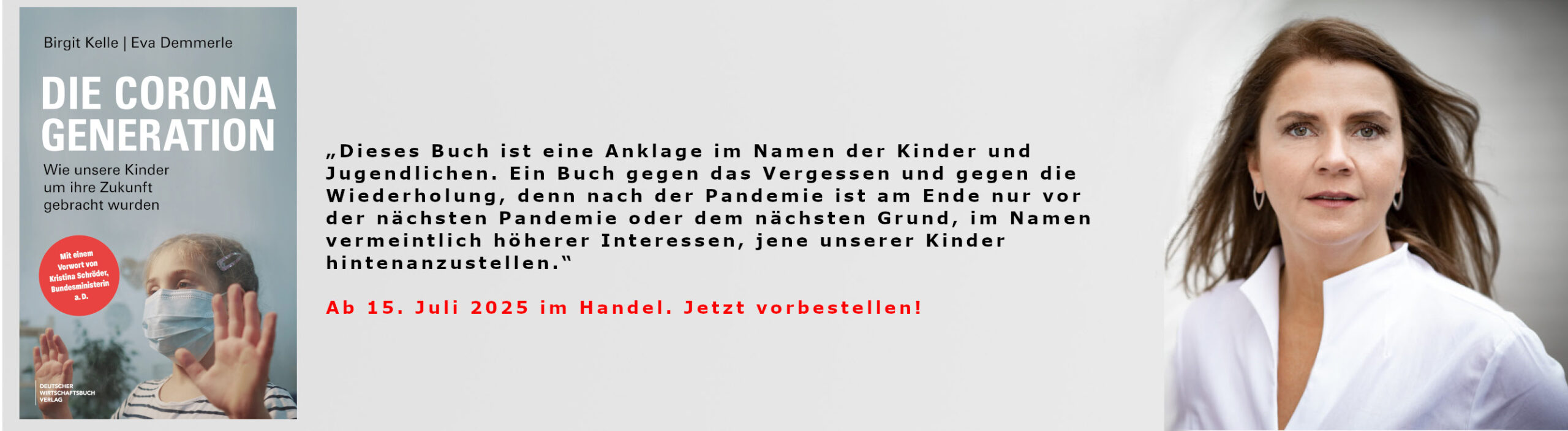Ich soll den Weg mit dem Herzen gehen, hatte mir ein Priester gesagt, meine Füße hatten dazu ihre ganz eigene Einstellung. Zwei Wochen auf dem Jakobsweg in Spanien. Ich hatte es für DIE TAGESPOST aufgeschrieben:
Eine Herbstwanderung auf dem Jakobsweg.
Ich hatte vergessen wie gut eine Tomate schmecken kann. Süß und fleischig, einfach mit etwas Salz bestreut und danach den übrigen Saft auf dem Teller mit der Zunge ablecken, so wie früher als Kind. Stilles Glück. Nach 28 Kilometern war ich fast weinend in der Herberge angekommen. Jetzt endlich aus den nassen Schuhen raus, etwas essen und vor allem: Nur noch den Weg bis in mein Bett heute schaffen müssen. Ein großartiger Gedanke.
Es ist Tag vier auf meinem Weg durch die Berge von Leon. Seit vielen Jahren begleitet mich der Gedanke, den Jakobsweg zu gehen. Genau so vielen Jahre fanden sich immer genug Gründe, es nicht zu tun. Die Kinder, die Arbeit, keine Zeit. Dann die spontane Erkenntnis, dass ich mit dieser Methode ziemlich alt werde, ohne jemals dort gewesen zu sein. Dass mich dieser Weg schon lange ruft, dass er geduldig wartet. Ich muss mich auf den Weg machen. Unbedingt. Ich finde in meinem Kalender nur das Zeitfenster vor Weihnachten und gebe mir selbst zwei Wochen frei für die letzten 300 Kilometer bis nach Santiago de Compostela.
Der innere Schweinehund hat dennoch viele Stimmen. Du hast doch sowas noch nie gemacht. Und dann als Frau alleine, ausgerechnet im Winter? Es ist doch Advent, du solltest jetzt Plätzchen backen für die Kinder, Lichterketten aufhängen und Geschenke besorgen. Soll es nicht diese besinnliche Zeit sein, in der wir alle auf die Ankunft des Herrn warten? Keine Ausreden mehr. Ich werde ihm dieses Jahr dann eben entgegen gehen. Aufbrechen statt abwarten. Wird er auch ein Stück mit mir gehen? Ich weiß nicht, ob wenigstens Gott Zeit hat, wenn meine schon so knapp ist. Auch als ich bereits im Flieger nach Spanien sitze, fühlt es sich immer noch surreal an. Aus der Hektik eines langen Jahres erwartet mich – ja, was eigentlich? Hoffnung. Ich sehne sie herbei. Hoffnung auf Ruhe, Zeit, das Loslassen von Verpflichtungen, auf den Raum, um unfertige Gedanken zu Ende zu bekommen.
„Hola Pelegrina!“ Der Fanziskaner-Pater in seiner braunen Kutte, ist der erste in Leon der mich anspricht. Im Winter sind nur eine Handvoll Pilger da. In meinem Zimmer zwei junge Italienerinnen aus Rimini und Aleksandra aus Russland, sie hat schon 500 Kilometer hinter sich, allein 44 davon gestern. Ich bin beeindruckt. Von ihrem riesigen Rücken-Tattoo und der Strecke. „Buen Camino“, der Pater entlässt mich morgens mit dem Jakobs-Gruß. Und ich solle nicht vergessen, dass man diesen Weg nicht mit den Füßen geht: „You have to go it by heart“.
Nach meinem ersten Tag werde ich 12 Stunden durchschlafen. 25 Kilometer liegen hinter mir, die letzten 15 gegen den Wind auf weitem Feld. Jeder Schritt ein Kampf. Ramme meine Wanderstöcke in den Boden, weil es sich anfühlt, als wolle mich der Sturm sonst wieder rückwärts schieben, abhalten, frustrieren. Ja, es klappt! Alle haben mich schon überholt. Alle! Ich bin so furchtbar langsam. Der Gedanke drängt sich auf, dass mir ein Widersacher die Tour gleich schon am ersten Tag so richtig versauen will. Kämpfe ich gegen den Wind, oder gegen mich selbst?
Es ist die erste Lektion von vielen, dass ich auf diesem Weg nicht selbst bestimme, wie schnell ich vorankomme. Dass meine Füße und das Wetter viel mächtiger sind. Wie soll ich denn mein Leben in den Griff bekommen, wenn ich nicht einmal meine eigenen Füße unter Kontrolle habe? „Dein Wille geschehe“, die Zeile aus dem Vaterunser bricht sich im Gehen immer wieder Bahn durch mein Gedankenchaos. Sein Wille geschehe. Tut es das nicht sowieso, egal was wir beten, egal was wir wollen? Nach vier Stunden Gegenwind macht mich diese Zeile richtig wütend. Ist die Frage nicht vielmehr, ob wir bereit sind, diesen Willen hinzunehmen, statt dagegen zu rebellieren? Wenn das Schicksal uns sowieso ereilt, wäre es nicht klüger, es anzunehmen? Die zweite Lektion bekomme ich kostenlos dazu: Mein Naturell taugt nicht zur Unterwerfung. Zuletzt las ich in Hartmut Rosas „Unverfügbarkeit“ über die philosophische Betrachtung, dass sich manche Dinge nicht erzwingen lassen. Schlimmer noch, je mehr wir es versuchen, umso mehr entrinnen sie uns. Begegnung mit Gott ist die ultimative Unverfügbarkeit. Ich fühle Ohnmacht.
Und dennoch gehe ich weiter, jeden Tag rund 25 Kilometer. Am zweiten Abend strande ich alleine in einem Kuhdorf. Der alte Mann wirft nur für mich den Gasofen an, um den Essraum warm zu bekommen, die Schlafräume haben gar keine Heizung, dafür sind die Duschen im Garten. Im Sommer ist das sicher bezaubernd. Jetzt stehe ich aber in der zwei-Kubikmeter-Zelle im Freien, draußen überträgt der Lautsprecher die Abendmesse aus der kleinen Kapelle in einer Lautstärke in den Ort, die jeden Muezzin vor Neid erblassen ließe. Ich wollte das ganze „Back tot he Roots“-Paket, ich bekomme es. Liege in meinem Hochleistungsschlafsack und friere die halbe Nacht, dafür gibt es morgens kein Frühstück. Wer hatte nochmal diese Idee?
Die Monotonie des stillen Gehens hat etwas Befreiendes. Jeden Tag schmerzen meine Füße. Jeden einzelnen Tag bis zuletzt. Es beginnt zuverlässig ab Kilometer zehn und bleibt für den Rest des Tages. Das Gute am Schmerz ist, dass ich manchmal über nichts anderes mehr nachdenken kann und den Rest vergesse. Alles andere verliert sich, leert sich.
Der andere Schmerz kommt immer unvermittelt, heftig und allumfassend. Die Unverfügbarkeit herrscht auch über diese Momente. Und dann bin ich dankbar, alleine zu sein, weine mit dem Regen, schimpfe lauthals und bin vor allem wütend. Wütend auf mich, auf andere, auf Gott, weil er mir nicht zuhört. Schlage meine Wanderstöcke in den Boden bis ich Angst habe das sie brechen. Und doch, immer wieder bekommen meine Füße unverhofft ein Schub, werden geflutet, und für Momente gehe ich wie auf Wolken. Es scheint für Gott einfacher zu sein, den Schmerz meiner Füße zu lindern, als jenen, den ich in mir trage. Wo ist meine Unerträglichkeitsgrenze? Aushalten. Sich zusammenreißen. Ich tue mich schwer damit, mir selbst einen Anspruch auf Überforderung zu gönnen.
Am Tag drei weiß ich sicher: Der Teufel fährt Taxi. Überall auf dem Weg finden sich Aufkleber, teilweise aufdringliche Plakate an Straßenschildern, auf Hauswänden, an Zäunen. Taxifahrer, die müden Beinen ihre Dienste anbieten. Der perfide Versuch, ermattete Pilger zum Aufgeben zu verführen. Wie verlockend nach 20 Kilometern, wie oft mag er erfolgreich sein vor allem im Sommer, wenn die Hitze ihr übriges beisteuert? Ich bin zutiefst entschlossen, zu widerstehen.
Nach fünf Tagen dann die Niederlage. Ich muss eine Etappe mit dem Bus fahren, meine Füße können nicht mehr, die Knöchel geschwollen. Zwei Stunden tigere ich in der Herberge herum, bis ich mich durchringen kann. Es fühlt sich an wie Aufgeben. Obwohl ich mir selbst im Vorfeld die Bus-Absolution erteilt hatte. Ich hasse es, nur zwei Wochen Zeit zu haben und keinen Tag, um auszuruhen. Beneide jene, die hier ohne Zeitlimit wandern. Ich habe einen Rückflug in zwei Wochen und muss rechtzeitig ankommen. Es hilft nichts.
Und dann wird es zum Glückfalls. Ich erkaufe mir damit Zeit und finde unverhofft meinen Schritt, höre auf, das Tempo der anderen zu laufen. Höre auf, Schritt zu halten, gehetzt zu sein. Mich selbst zu hetzen. Es gibt kein Soll zu erfüllen, keine Leistung zu vollbringen. Ich lerne, mir meine Pausen zu nehmen, inne zu halten. Und erschrecke in der Frage: Wie vielen Menschen dränge ich mit meiner Energie eigentlich meinen Schritt auf, mein Tempo, meine Perspektive?
Was sind das nur für Pilgerstreber, die ohne Frühstück im Dunkeln morgens aufbrechen, so meine Gedanken in den ersten Tagen, angesichts jener, die bereits aus der Tür waren, als ich noch schlaftrunken meine Morgenfüße beweine. Doch seit Tag sechs gehöre ich selbst zu ihnen. Und verstehe. Den unbezahlbaren Moment, wenn du bei Sonnenaufgang bereits oben auf dem ersten Berg bist. Der Himmel pink und orange brennt, und über der Nebelsuppe im Tal strahlt. Ich stampfe im Stockdunkeln durch den Morgenfrost unheimlicher Wälder, die ich zu Hause nur unter Androhung von Gewalt alleine betreten hätte. Und ich habe keine Angst. Wovor auch? Wo, wenn nicht hier, ist man in Gottes Hand? Tagelang Sonnenschein in Galizien. Es ist ein Traum. Ein sonnendurchfluteter Hohlweg reiht sich an den anderen. Windschiefe Eichen, die ihre gelben und roten Äste wie schützende Arme über die Wege gelegt haben. Ich wate in raschelndem Herbstlaub. Läute eine Kirchenglocke, einfach nur weil die Kette draußen hängt und freue mich wie ein kleines Kind, das mich niemand erwischt. „You look so happy“ sagt der Koreaner-Gefährte zweimal, als wir bei der ersten offenen Bar in der Sonne sitzen und einen Cafe Americano trinken. Ja. Pure Freude über das Hier und Jetzt.
„Und hast du auch Gott getroffen?“ fragt mich ein Freund, als ich zurück bin. Ich habe Menschen getroffen. Wir waren Gefährten, alle auf demselben Weg, auch wenn man sich zeitweise aus den Augen verliert. Du musst hier keinem etwas erklären, ein unausgesprochenes, gegenseitiges Verstehen liegt über dem Weg. Es heißt, der Camino gibt dir, was du brauchst. „Die kleinen Camino Wunder“. Ja, ich habe sie gefunden. David, der Jesus-Verschnitt, ohne Socken in Sandalen holzhackend morgens im Nirgendwo. Seine Frühstücksbar wie eine Fata Morgana in der Wüste. Er will partout nicht einmal eine Spende annehmen. „This is all about giving“.
Oder Thomas der Kreuzritter, sein Bretterverschlag mit Plastikfoliendach rettet uns den nassen Hintern, als der Wolkenbruch uns auf dem Berggipfel einholt. Wir kauern um den glimmenden Holzofen und teilen uns Espresso in Plastikbechern. Der schweigsame Franzose, der mir vormacht, wie man einen Geröllhang wie eine Bergziege hinunterrennt und damit locker einen Zweistundenabstieg auf den rutschigen Steinen auf 15 Minuten reduziert. Ich jogge samt Rucksack ins Tal. Vernunft aus, Adrenalinspiegel am Anschlag.
„Manchmal denke ich, ich sollte einfach weiterlaufen und nicht zurückkehren“ hat ein Freund in diesem Jahr schon zweimal zu mir gesagt. Ich hatte Tage auf dieser Wanderschaft, da verstand ich die Kraft dieses Gedanken. Weiter gehen und nicht zurückkehren. So wie Juan, der mir erzählt, er habe ein paar Tage seine Tochter vergessen. Marie, die 69-Jährige, die seit über sieben Jahren zu Fuß unterwegs ist. Das deutsche Paar, das von Belgien bis nach Spanien durchgelaufen ist. Huyin aus Taiwan, die bereits die Mongolei und den Balkan durchquert hat. Sven aus dem Schwarzwald, der den Camino in diesem Jahr schon zum zweiten Mal gegangen ist. Der schweigsame Franzose, der trotz Minusgraden lieber bei seinem Hund draußen schläft. Es hat etwas von Freiheit, aber auch vom Davonlaufen. Jeder hat seine Gründe, zu gehen. Jeder Ballast im Rucksack. Vielleicht sind die steinigen Geröllhänge in Wahrheit die Schuttberge, die Millionen Pilger hier in den letzten Jahrhunderten mitgebracht und abgeladen haben.
Es regnet die letzten 20 Kilometer meines Marsches. Wie eine dunkle Wolke hängt mein Echtleben als Bedrohung am Himmel, es wird mich einholen und verschlingen. Und dann stehe ich am Ziel auf dem verregneten Platz vor der Kathedrale von Santiago de Compostela und fühle mich das erste Mal abgrundtief einsam. Stromere allein durch die Stadt. Kämpfe erfolglos gegen die Tränen. Alles ist sinnfrei und leer. Was soll ich jetzt tun? Suche gegen Abend die Kirche für die Pilgermesse und entdecke meinen Franzosen in einem Hauseingang. Der Hund schläft, die Whiskeyflasche ist halb leer. Einen Moment sitzen wir beieinander im Regen. Komm mit in die Messe, sage ich, hol dir deinen Segen. Er wehrt ab. „Wohin wirst du jetzt gehen“ frage ich ihn zum Abschied. „Vielleicht weiter nach Fatima, oder nach Hause, ich weiß nicht“. Ich bekomme ein erstes zaghaftes Lächeln von meinem Gefährten Frenchman. Treffe viele Andere in der Messe. Michael, den Park-Ranger, mit dem ich unterwegs ein Sixpack und eine Nacht zu zweit im Nirgendwo in einem 60-Betten-Saal geteilt hatte. Die Australier, die mir spontan um den Hals fallen: „God bless you“. Wir betrinken uns, lachen, singen lauthals, freuen uns gemeinsam über den Weg, den wir alle geschafft haben. Es ist befreiend. Ein guter Abschluss.
Es ist Sonntagabend am zweiten Advent. Ich liege im Dunkeln auf dem Rücken auf den kalten Steinen vor der Kathedrale. „You are kind of mad“ lacht Park-Ranger-Michael bevor er sich danebenlegt und wir zusammen die beeindruckende Fassade rückwärts von unten anstarren. Einfach weil es schön ist. Menschen laufen vorbei, niemand stört sich hier noch an irren Pilgern, die seltsame Dinge tun. Stromere danach wieder durch die Stadt, gehe nicht mit den anderen tanzen. Es ist gut so. „Aber bist du denn nun Gott begegnet auf deinem Weg“, die Frage des Freundes blieb unbeantwortet. Ich bin mir selbst begegnet. Das war schon aufwühlend genug.
Dieser Artikel erschien am 19. Dezember in „Die Tagespost“. Hier als PDF herunterladen.