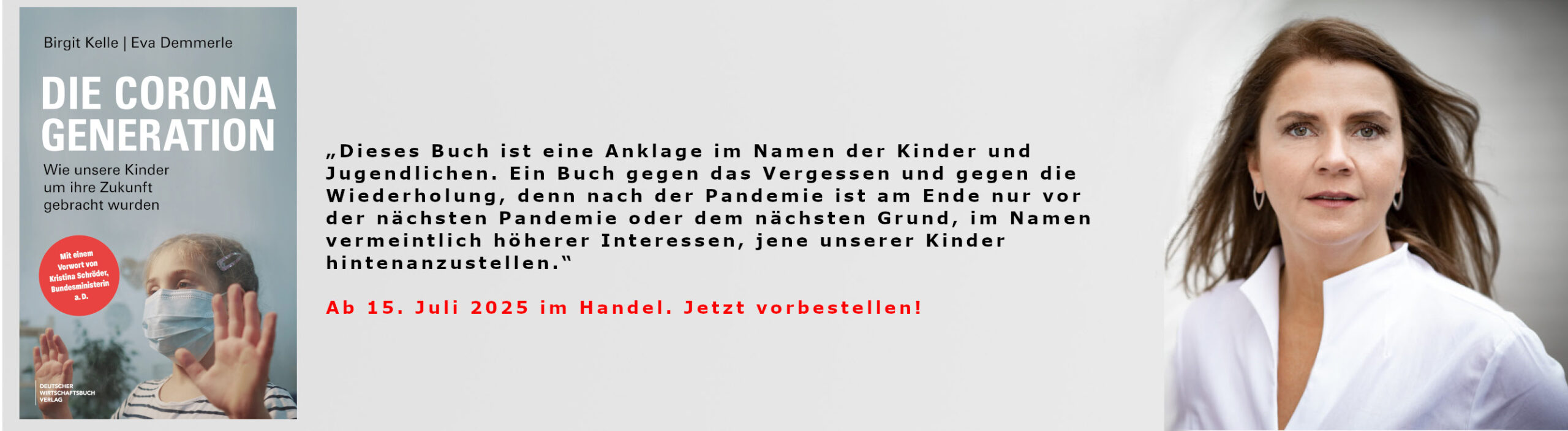James Bond wird ein Mann bleiben. Wenigstens einer ist uns Frauen noch sicher angesichts von Bestrebungen, die vielzitierte, ominöse „toxische“ Männlichkeit auch aus den Kinosälen zu verbannen und durch starke Frauen, alternativ männliche Weicheier zu ersetzen. Seit die politische Korrektheit auch die Besetzungscouchen in Hollywood erreicht hat, wird uns alljährliche bis hin zu den Oscar-Verleihungen vorgerechnet, wie wenige Frauen, Schwarze und Bisexuelle eine Hauptrolle in einem Drehbuch bekommen haben. Der Kampf gegen die Geschlechterdiskriminierung macht neuerdings auch vor den Kinosesseln nicht Halt. Wäre ja noch schöner, wenn der Zuschauer und auch die -*In selbst entscheidet, wen oder was sie auf der Leinwand sehen will, so als hätten uns die pädagogischen Filmvorführungen in der Schule nicht für den Rest unseres Lebens gereicht. Zuletzt floppte mit dieser Methode das im Vorfeld medial stark gehypte Remake von „Drei Engel für Charlie“ an den Kinokassen, weil man die Menschen ja nicht zwingen kann, sich auch noch in ihrer Freizeit feministisch belehren zu lassen. Sie gehen dann eben in einen anderen Film, auch wenn dieser ganz doll neue Frauenrollen zeigt.
Möglicherweise wäre es sinnvoll, nicht jedes Mal eine verkniffene Debatte alternativ eine präventive Lobhudelei auf den Frauenanteil loszutreten, sondern einfach mit großer Selbstverständlichkeit Actionheldinnen über die Leinwand wüten und selbst überzeugen zu lassen. Ein Actionfilm wird nämlich nicht besser, dadurch dass eine Frau kämpft, sondern nur dadurch, dass eine Frau gut kämpft und das Drehbuch etwas taugt. Das kann dann nicht nur inhaltlich, sondern auch ökonomisch gut gehen, wie zuletzt Captain Marvel gezeigt hat. „Das bin ich in 20 Jahren“ war der Kommentar meiner 10-Jährigen im Kino, angesichts der Schauspielerin Brie Larson als Heldin der Geschichte. Ja, das Konzept Superheldin tut kleinen Mädchen durchaus gut. Deswegen muss man den großen Mädchen aber doch nicht ihre Helden nehmen, oder gar einen jahrzehntealten Film-Mythos mutwillig demontieren.
Die großartigen Actionheldinnen der Filmgeschichte kamen bislang ohne vorauseilende politische Belehrung aus, sie überzeugten schlicht mit ihrer schauspielerischen Leistung. Sigourney Weaver bekämpfte schon in den 70ern erfolgreich Aliens, meine persönliche Heldin war und ist Linda Hamilton im Kampf gegen den Terminator und Jennifer Lawrence als Katness Everdeen würden meine Töchter als obsolut „Fire“ bezeichnen, was wohl so viel heißt wie, die ist echt cool. Bond-Produzentin Barbara Broccoli, eine Frau, hat nun den Spekulationen, ob auf Daniel Craig wohl endlich feministisch korrekt eine Frau als Agent*In 007 folgen wird, eine Absage erteilt. Gut so. Wer auch immer als nächster Bond-Darsteller kommt, er wird es sowieso schwer haben, denn nie gab es einen besseren Bond als Daniel Craig. Er liebt, er schwitzt, er scheitert – er ist Mensch. Eine Liebeserklärung, an einen Mythos:
Ich gestehe, es war keine Liebe auf den ersten Blick zwischen James und mir. Als ich mit zwölf Jahren meinen ersten „Bond“ schaute, war er schon seit 25 Jahren im Dienst ihrer Majestät. Ich verfolgte die Filme mit der gleichen Begeisterung, wie ich auch Bud Spencer und Terence Hill schaute: ohne tieferen Sinn, ohne politisches Verständnis, ohne Leidenschaft. Einfach Action, witzige Szenen. Ein immer gutaussehender Spion, der jede Dame, die nicht bei drei auf den Bäumen war, flachlegte – und dabei tadellose Anzüge trug. Das reicht, wenn man 12 ist. Aberwitzige Drehbücher und unrealistische Stunts störten mich nicht weiter, bei Bud und Terence ja auch nicht.
Vielleicht muss man erst älter werden, um sich für oder gegen eine Filmfigur zu entscheiden. Um mehr zu verlangen, als einen gut aussehenden Helden umgeben von hübschen Frauen mit albernen Namen wie Pussy, Kissy, Tracy, Honey und wie sie alle hießen. Die alten „Bond“-Streifen taugen heute nur noch unter dem Aspekt Tradition und Comedy. Und es bleibt spannend zu sehen, was man sich vor 30 oder 40 Jahren als maximale Zukunftsbedrohung vorstellte. Die Bösen waren noch die Russen und nicht alte blonde weiße Männer. Jeder neue „Bond“-Streifen war für seine Zeit spektakulär. Nach heutigen Maßstäben ist die Action hingegen oft albern, das Frauenbild eine Katastrophe und der Held zu glatt. James als Mann ohne Vergangenheit, immer gut gelaunt, nie um eine Lösung verlegen, einen Drink in der Hand und am Schluss sank er mit einer Schönen in den Armen in die Kissen. Bitte weckt mich, wenn es vorbei ist.
Meine Zeit als Bond-Groupie begann erst mit Daniel Craig. Was für eine Offenbarung! Endlich kein Schönling mehr. Endlich ein richtiger Mann. Ja sicher, Sean Connery sah auch nicht schlecht aus. Selbst Pierce Brosnan konnte ich aus weiblicher Sicht zumindest etwas abgewinnen, und sie waren beide so richtig britisch bondmäßig. So, wie man sich im schönsten Klischee den Engländer vorstellt. Allein das ist heute vermutlich politisch schon wieder schwierig. Klischees leben auf der Leinwand länger, als im Feuilleton. Wie Brosnan sich bei der Bootsverfolgung auf der Themse unter Wasser die Krawatte geradezieht, ist einfach unerreicht. Mehr Bond geht nicht. Aber mal ehrlich, auch das war doch Comedy. Eine Karikatur des klassischen Spions aus Zeiten, als die Verbrecherwelt noch klar in Gut und Böse aufgeteilt war. Brosnan war schon der Versuch eines Übergangs. Der alte Bond in neuem Gewand. Und im Versuch der Erneuerung doch tragisch gescheitert, weil man dann doch nicht den Mut fand, sich vom Alten zu lösen, aus Angst, Bond dabei zu verlieren. Alte Figur mit neuer Technik. Nicht überzeugend in der realistischen Echtzeit angekommen. Immer noch ausgestattet mit den Jungs-Spielzeugen von Q zwischen explodierenden Kugelschreibern und ferngesteuerten Autos. Für immer in der Schleudersitzzeit festgenagelt.
Seit Daniel Craig hat Bond endlich auch ein Leben. Er ist anders, als alle seine Vorgänger. Bullig, muskulös. Trägt Anzüge, nicht weil er darin gut aussehen will, sondern weil er muss. Einer, den man auf den zweiten Blick erst umwerfend findet, weil er nicht so offensichtlich als gutaussehend durchgeht. Seit Craig ist endlich Realismus bei Bond eingezogen. Schlägereien sind blutig, Morde anstrengend. Es ist ein schmutziges Geschäft. Quälend lang braucht er in Casino Royale, um mit Vesper Lynd den Afrikaner im Treppenhaus mit bloßen Händen zu erledigen. Spionageromantik go home! Man muss sich als Zuschauer nicht mehr ärgern, weil das Drehbuch hanebüchen ist und sich mit einem Augenzwinkern über physikalische Gesetze hinwegschreibt. Hey, nimm es nicht so ernst, es ist doch nur ein „Bond“ und jetzt fliegen wir mit einer Rakete auf einer Samtcouch ins Weltall.
James hat endlich auch eine Vergangenheit als Mensch. Als Mann! Er hatte plötzlich Kanten, Zweifel, Gefühle. Er ist nicht mehr smart, sondern eigenwillig, unberechenbar. In „Casino Royal“ findet er die Liebe seines Lebens. Ja, das lässt uns Frauen seufzend in den Kinosesseln tiefer rutschen. Also jedenfalls jene, die sich auch noch Türen aufhalten und den Koffer tragen lassen. Der Held, der wenn auch nicht ein ganzes Empire, aber doch wenigstens ihre Majestät in den Wind schießt, um ganz neu anzufangen. Für eine Frau. Prinz Harry könnte sich aktuell noch was in Sachen Konsequenz davon abschneiden. Ein harter Knochen, der angesichts einer weinenden Frau in die Knie geht. Ohne in Kitsch abzudriften oder gar an Männlichkeit zu verlieren. Genauso verletzlich, wie die Schöne, die er bis zum letzten Atemzug mit seinem Leben verteidigen würde. Ja endlich habt ihr auch für erwachsene Frauen etwas ins Drehbuch geschrieben. Danke! Frauen nicht mehr rein als austauschbares Vergnügen und dumme Mäuschen. Er vögelt jetzt nicht nur junge Hühner, sondern auch gestandene Frauen wie Monica Belucci.
Doch dann dieser Verrat, die Enttäuschung, dass ausgerechnet jene Frau, für die er alles aufgeben wollte, ihn hintergeht. Sie hat ihn flachgelegt, mal eine ganz andere Variante. Der Nachfolger „Ein Quantum Trost“ war ein einziger Rachefeldzug für Vesper Lynd. Als Drehbuch schwach, menschlich für die Bond-Figur aber konsequent.
Und dann „Skyfall“. Ich verneige mich! Eine Abrechnung mit allen Bond-Klischees. Ein für alle Mal. Schluss mit den Kindereien. Nur um den Aston Martin tut es mir doch ein bisschen leid, aber wie es aussieht, ist Q noch am Basteln, um ihn wieder hinzubekommen. Der Schrauber im Mann stirbt wohl auch zuletzt. Alles kommt auf den Tisch. Seine Kindheit, der tragische Tod seiner Eltern. Seine Einsamkeit. Die Zweifel an der Loyalität zu England, zu M, zu allem. Wir sehen das erste Mal nach Jahrzehnten einen Bond mit Todessehnsucht. Einer, dem alles egal ist, der säuft, um zu vergessen. Fallen gelassen und am Ende.
Und wieder ist es eine Frau, die ihn aus dem Sumpf holt. Seine Mutter-Sohn-Beziehung zu M, sensationell gespielt von Judi Dench. Keiner von beiden will zugeben, wie sehr man inzwischen doch aneinander hängt. Sich braucht. Und doch ist es so offensichtlich und schon seit „Casino Royale“ vorbereitet. Sie sind beide harte Knochen, zusammengeschweißt angesichts einer realen Bedrohung, aber auch durch politische Kräfte, die beide als Relikte einer alten Zeit in den Ruhestand versetzen wollen. Wer starke Frauenrollen sucht, hat hier eine der besten.
Und so war Skyfall nicht nur ein Showdown gegen Bösewicht Javier Bardem, der einen Oscar verdient hätte für seine Inszenierung des gefallenen Agenten Silva, sondern auch ein Showdown zwischen der neuen und der guten alten Zeit. Zwischen Cyberwelt und Jagdmessern. Auch zwei Bond später wird das Jagdmesser und der selbst entscheidende Mensch in der Konkurrenz zum technischen Drohnenkrieg immer noch vorne liegen. Gut, ich gebe zu, es hat ein bisschen was von „MacGyver“ und „Kevin allein zu Haus“, wie die finale Schlacht auf „Skyfall“ vorbereitet wird, aber was soll‘s: Er gewinnt am Schluss und er weint um M. „M“, wie Mutter.
Bond wird auch noch weitere 50 Jahre gegen die Bösewichte dieser Welt kämpfen und ich werde ihn lieben. Der neue Boy‘s Club beim MI6 verspricht zudem einen hohen Spaßfaktor im Drehbuch und selbst Moneypenny hat seither nicht nur Hintern, sondern auch Hirn. Er wird sich nie mehr ernsthaft verlieben, dafür haben ihm die Frauen zu sehr zugesetzt. Also wieder austauschbares Vergnügen. Vesper hat es für uns Frauen für immer versaut. Die Schlampe ist tot. Darauf einen Bourbon, aus der Flasche, scheiß auf den Martini.
Der Text erschien erstmals am 17.01.2020 bei FOCUS Online.
Die Kolumne VOLLE KELLE finden Sie auch hier bei FOCUS ONLINE.