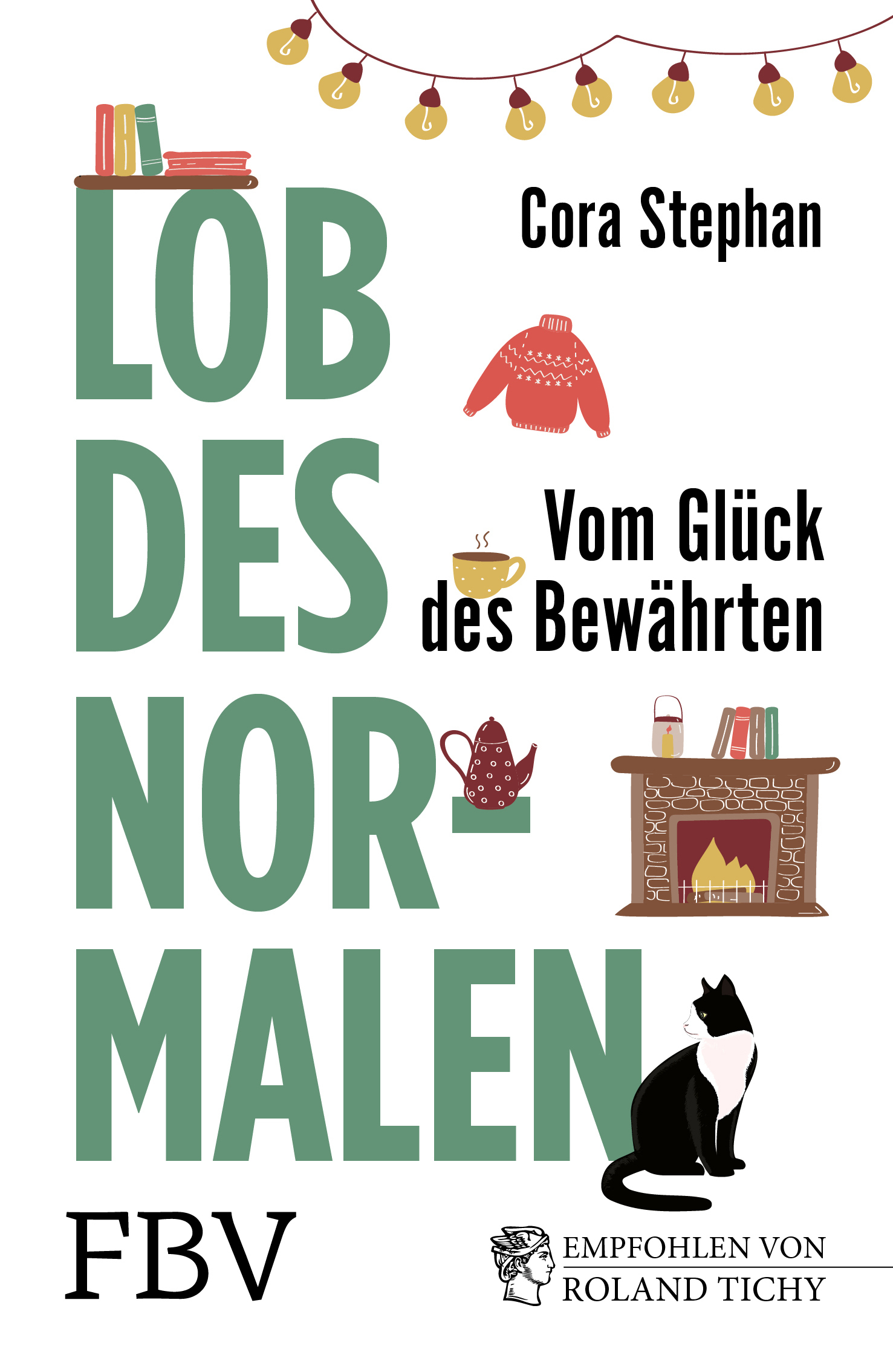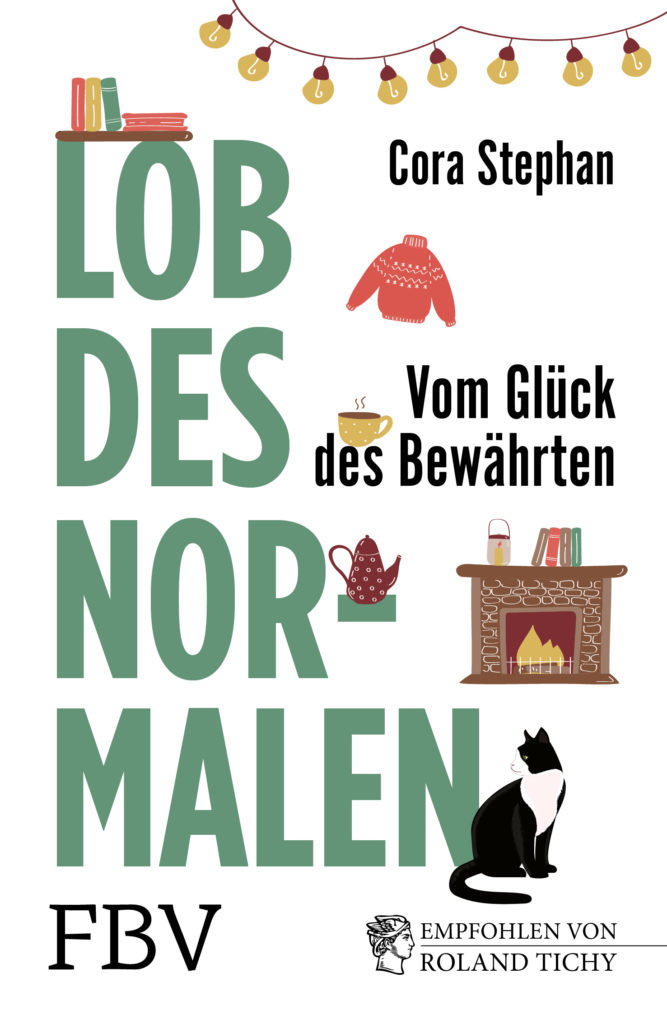
Schon wieder ein Buch das man kaufen muss. Der großen Cora Stephan ist mit LOB DES NORMALEN nicht nur eine Hommage an uns alle gelungen, die ganz Normalen dieses Landes, ja die absolut stinknormalen Durchschnittsmenschen, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, ihre Kinder anständig großziehen, Steuern zahlen, noch wissen, dass Rukola früher Rauke hieß. An all jene, die nicht etwa in der Hauptstadt auf einem bunten Sessel sitzend bei veganem Knabbergebäck die fünfte Dating-App programmieren, sondern noch diese ganz normalen Berufe haben, wie Lehrer, Krankenschwester, Installateur und Schreiner, an die korrekten Sachbearbeiter, die Schrebergartenbesitzer, die Häuslebauer und Sparer, weil sie es sind, die dieses Land zusammenhalten. Nein es ist viel mehr, als nur das „Lob“, das der Titel verspricht und hält, denn es ist ein bisschen wie mit dem Bestseller von Manfred Lütz, „Irre, wir behandeln die Falschen“, man kann sich nach der Lektüre beruhigt zurücklehnen, ein Bier aufmachen und aufatmen, weil man weiß: „Ich bin völlig normal, die anderen sind die Irren!“ – Und ja, von denen finden sich reichlich und immer mehr in dieser Republik, sie alle werden in dem Buch fein säuberlich in der Luft filetiert. Obwohl es stilistisch alles andere als aggressiv daher kommt, ganz im Gegenteil. In aller Seelenruhe, kann man förmlich den Luftzug der Schnappatmung im grünen Genderseminar zur nachhaltigen Rettung der Erde spüren, wenn Cora Stephan die heiße Luft der Weltenretter, der Gutmenschen, der Gendersprachler, der Antikapitalisten und toleranzbesoffenen Multikultitänzer Stück für Stück auseinandernimmt.
Das kann die doch nicht einfach so sagen! Doch kann sie. Und es ist eine Wohltat, ein Buch in der Hand zu halten, das all jene Dinge beim Namen nennt, die so vielen inzwischen unfassbar auf den Sack gehen (sollten sie noch nicht ganz enteiert sein). Dass sie sich nicht darum schert, ob sich gerade jemand wieder als Opfer einer Mikroaggression betrachtet, nur weil man ihm die Wahrheit ins Gesicht sagt: Dass es normal ist, dass man erstmal für sich und die Seinen sorgt, und nicht für den Rest der Welt. Normal, Fremde fremd zu finden, sein Häusle zu bauen, Kinder zu kriegen, sein Geschlecht mit nur zwei(!) Alternativen aus Mann und Frau bereits ausreichend bestimmen zu können. Normal, verwurzelt zu sein an einem Ort, Heimat zu lieben, Sitten, Bräuche und Gewohnheit. Weil das Leben sonst auch zu anstrengend wäre, wenn wir nicht halbwegs sicher wüssten, wo wir herkämen und wo wir hin sollen. Wenn wir jeden Tag neu aushandeln müssten, gar noch mit Zugezogenen, was richtig und falsch ist, was zu tun und zu lassen sei.
Und so ist dieses Buch eine Absage an die überdrehte, anstrengende Moderne, die sich täglich neu erfinden muss. Gott, was ist das anstrengend! Und überhaupt dieser ganze Beziehungsstress, der heute herrscht, dieses ständig und mit jedem Sex haben zu müssen, als ob man nicht schon müde genug ist vom Tag. Aber nein, jetzt wollen schon wieder alle darüber reden, alles problematisieren. Hatten wir das nicht schon in der ersten sexuellen Revolution? Jetzt wieder neu diskutiert mitten in der Paradoxie einer Generation, die die Ehe ihrer Eltern für überholt hält gleichzeitig dennoch gerne heiratet und an der überdrehten und aggressiven LGBTTIQ-Front mitmarschiert, die jetzt unbedingt jeden mit jedem verheiraten will, der nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Und dann habe ich als Konservative auch noch was gelernt: Auch die „Ehe für Alle“ kann man positiv betrachten. Weil sie doch wie alle Ehen schon immer der Gesellschaft nutzt, Stabilität schafft, Verantwortungsgefühl stärkt, Versorgung garantiert und den Staatshaushalt entlastet, der Staat sie also gerne anerkennen kann. Gut, meine Kirche muss das ja nicht absegnen, aber frei nach dem schwulen Autor Jonathan Rauch, den sie zitiert, ist das beste Argument für die schwule dasselbe, wie für die heterosexuelle Ehe: Der Mann ist von der Straße runter, macht keinen Unfug und holt sich nicht irgendwo noch eine Geschlechtskrankheit. Die Ehe also als das ultimative Domestizierungsprogramm für den hormonell übersteuerten alten weißen Mann. Kurz kam mir der Gedanke, dass es auch die ultimative Rachestrategie des Feminismus sein könnte, wenn die überreizten jungen Damen des Netzfeminismus den alten weißen Mann einfach heiraten, um ihn final zu erledigen, aber wahrscheinlich haben sie zu viel Angst, es könnte ihnen am Ende noch in dieser völlig normalen Beziehungskonstellation heimlich viel besser gefallen als in der non-binären Wohngemeinschaft mit Lebensabschnittspartner*In.
In diesem Buch stehen so viel Selbstverständlichkeiten, die man früher mit dem gesunden Menschverstand leicht erfassen konnte, heutzutage aber ständig ausgeredet bekommt. Der Österreicher nennt das übrigens den „Hausverstand“, was ich als Begriff hier gar passender finde, weil er das Wissen der Normalos beschreibt, wie es in Haus und Heim, am Küchentisch, in der Nachbarschaft gedeiht, dort wo Bewährtes eingekellert und Untaugliches vom Hof gejagt wird.
Dabei liefert das Buch gerade nicht einfaches Gedankengut oder gar populistische Parolen, sondern ganz im Gegenteil historisch fundierte Begründungen und Herleitungen für das, was uns heute so selbstverständlich scheint, aber auch kleine Perlen, die man fast überliest. Wie etwa die Neuinterpretation des emotionalen Unglücks einer Madame Bovary, die möglicherweise gerade nicht am Spießertum ihrer Umgebung zugrunde ging, sondern an der eigenen, falschen Erwartungshaltung an eine immerwährende leidenschaftliche Beziehung.
Im Fazit möchte ich die Autorin einfach selbst zitieren. „Man verachte das schlichte Glück des Spießers nicht“. In meinen eigenen Worten: Irre kommen und gehen, Menschen wie Cora Stephan bleiben. Und das ist auch gut so.